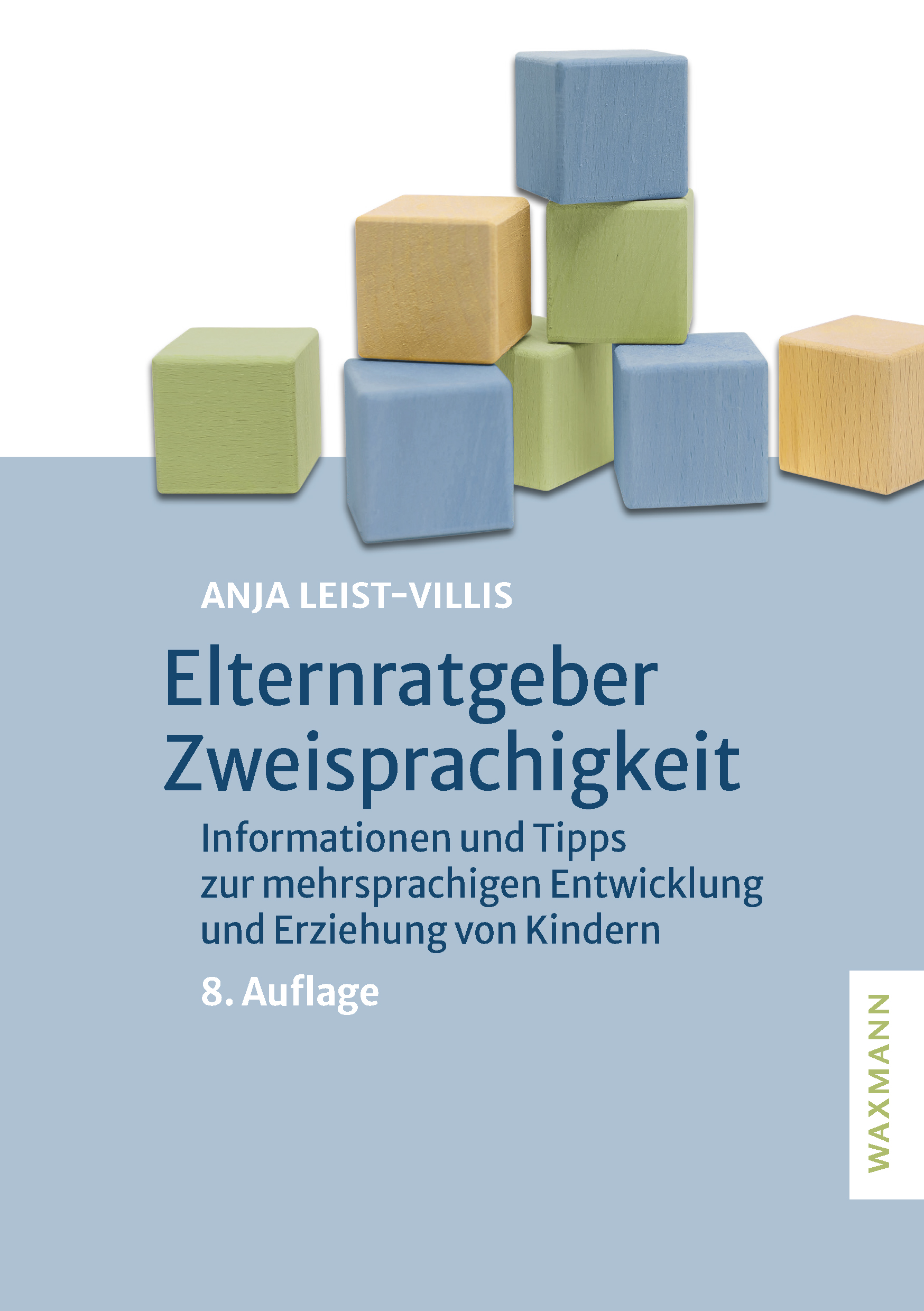„Man
kann nicht immer konsequent sein“
Mehrsprachige
Erziehungsprozesse
Die folgenden
Ausführungen basieren auf Ergebnissen einer empirischen
Studie, in der hundert Mütter aus
griechisch-deutschen Familien interviewt wurden: griechische Mütter in
Deutschland und deutsche Mütter in Griechenland - die Mutter sprach
also jeweils die "Nichtumgebungssprache".
Zur
generellen Frage: Wie erwerben Kinder Sprache: www.sprachfoerderung.info
www.sprachfoerderung.info
Die
Methode „eine Person – eine Sprache“ - "OPOL" (one person –
one language) besagt, dass jedes Elternteil eine
andere Sprache (meist seine eigene Muttersprache) mit dem Kind spricht.
Für eine griechisch-deutsche Familie in Deutschland würde das bedeuten,
dass die griechische Mutter mit ihrem Kind griechisch, und der deutsche
Vater deutsch spricht. Diese Regel ist allerdings in ihrer Reinform
weder im Alltag umsetzbar, noch entspricht sie dem Wesen der
Mehrsprachigkeit (der Eltern): Ihre Sprachen sind miteinander in
Kontakt, sie bilden zusammen ihre spezifische Sprachkompetenz. Die
Konzentration auf nur eine der Sprachen entspricht nicht dem Wesen
dynamisch gelebter Mehrsprachigkeit.
 Mehrsprachigkeit ist...
Mehrsprachigkeit ist...
Dennoch sind
die befragten Eltern von der Sinnhaftigkeit dieser Methode
grundsätzlich überzeugt: Fast alle
(97%) sind der Meinung, dass Mutter und Vater mit ihrem Kind
grundsätzlich ihre eigene Muttersprache sprechen sollten, und dass eine
konsequente Anwendung der Methode „eine Person – eine Sprache“ den
Spracherwerbsprozess des Kindes unterstützt (75%).
In ihrer praktischen
Umsetzung spiegeln sich jedoch die oben angedeuteten Schwierigkeiten.
Sie betreffen vor
allem dasjenige Elternteil, welches die Sprache spricht, die nicht
Sprache des Landes ist, in dem die Familie lebt – die sog.
Nichtumgebungssprache. Ein Großteil (hier: 83%) von ihnen spricht zwar
in den ersten Lebensjahren des Kindes noch konsequent mit ihm diese
Sprache. Viele von ihnen (hier: 66%) sprechen im Laufe der Zeit jedoch
zunehmend die
Umgebungssprache mit ihrem Kind. Insbesondere die Anwesenheit von
Personen, die die
Nichtumgebungssprache nicht verstehen, führt in vielen Fällen (hier:
64%) zu einem Wechsel in die Sprache der Umgebung.
Die
Diskrepanz zwischen dem eigenen Anspruch an das
Spracherziehungsverhalten und den Schwierigkeiten seiner praktischen
Umsetzung wird von den Betroffenen häufig als Konflikt empfunden, der
sich in einem Gefühl der Unzufriedenheit, der Schuld und des Versagens
niederschlägt: 93% derjenigen Mütter, die sich eng an „eine Person – eine
Sprache“
halten, geben an, sehr zufrieden mit
dem gesamten Verlauf des zweisprachigen Entwicklungs- und
Erziehungsprozesses sind, dagegen nur 43% derjenigen, die viele
Ausnahmen machen.
Eine deutsche Mutter in
Thessaloniki:
"Ich bin nicht sehr zufrieden. Ich bin selbst schuld, denn ich spreche
selbst auch viel griechisch mit den Kindern. Ich müsste mich mehr
dahinter klemmen."
Eine griechische Mutter in München:
"Ich habe immer mehr deutsch gesprochen. Im Nachhinein ist die Trauer
massiv und das Bedauern tief, dass meine Kinder mit mir nicht
griechisch sprechen. Mit meiner vierten Tochter habe ich dann sehr viel
griechisch gesprochen."
Ursachen
sowohl für die Schwierigkeit, die Methode konsequent umzusetzen, als
auch für das Gefühl der Unzufriedenheit sind zum einen in
Persönlichkeitsmerkmalen, wie z.B. Umgang mit Höflichkeitsformen,
Selbstbewusstsein, der persönliche Bezug zum Herkunftsland zu suchen.
Aber auch zahlreiche äußere Faktoren haben einen Einfluss:
Die
geringen
Griechischkenntnisse eines deutschen Vaters in einer
griechisch-deutschen Familie können mit der Zeit dazu führen, dass die
griechische Mutter in seiner Gegenwart deutsch anstatt griechisch mit
dem Kind spricht (hier: in 77% der Fälle): Im Alltag ist es einfacher,
direkt für alle verständlich deutsch zu sprechen, als sich dem Kind
gegenüber auf Griechisch zu äußern und das Gesagte anschließend für den
Partner zu übersetzen.
Bei
guten
Sprachkenntnissen des Partners entfällt dagegen die Notwendigkeit der
Übersetzung, was wiederum die Verwendung der griechischen Sprache
innerhalb der Familie vereinfacht.
top


Sprachliche Zusammensetzung des
sozialen Umfeldes
Ein
konsequentes
Spracherziehungsverhalten wird durch ein Umfeld erschwert,
in dem ein Großteil der Personen nur die Umgebungssprache versteht und
spricht. Viele fühlen sich ausgeschlossen oder empfinden es als
unhöflich, wenn in ihrer Gegenwart eine Sprache gesprochen wird, die
sie nicht verstehen (egal, ob das gesagte sie betrifft oder nicht). In
derartigen Situationen wechseln viele Eltern (hier: 64%) auch im
Gespräch mit ihrem Kind in die Sprache der Umgebung.
In
Gegenwart von
Personen, die selbst die Nichtumgebungssprache sprechen, ist ihre
Verwendung dagegen ganz natürlich und selbstverständlich. Kontakte zu
ihnen unterstützen ein konsequentes Spracherziehungsverhalten und eine
generelle Zufriedenheit mit der mehrsprachigen Lebenssituation.
 Mehrsprachigkeit
im
sozialen Kontext
Mehrsprachigkeit
im
sozialen Kontext
top


Kontakte
zu Personen, die selbst Erfahrung mit Mehrsprachigkeit haben
Kontakte
zu Personen, die selbst Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit haben – sei
es, weil sie selbst mehrsprachig sind, oder weil sie auch in einer
gemischtsprachigen Ehe leben – wirken sich sowohl auf das konsequente
Spracherziehungsverhalten als auch auf die allgemeine Zufriedenheit
mit der sprachlichen Situation positiv aus: In ihrer Gegenwart wird
Sprachenvielfalt als Normalität erlebt, werden
Spracherziehungsmodelle, Ratschläge und Informationen geboten und
generell das Gefühl vermittelt, dass schwierige Phasen des
mehrsprachigen Entwicklungs- und Erziehungsprozesses keine Ausnahme
darstellen.
 Mehrsprachigkeit
im sozialen Kontext
Mehrsprachigkeit
im sozialen Kontext
top


Ein
hoher Anteil an generell positiv eingestellten Personen unterstützt
sowohl das konsequente Verhalten der Eltern als auch ihre Zufriedenheit.
 Mehrsprachigkeit
im sozialen Kontext
Mehrsprachigkeit
im sozialen Kontext
 Einstellungen pädagogischer Fachkräfte
Einstellungen pädagogischer Fachkräfte
top


98%
der deutschen Mütter in Griechenland erlebten eine ausdrückliche
Wertschätzung ihrer Muttersprache („Ah, Ihr Kind lernt deutsch! Das ist
aber toll!“), griechische Mütter in Deutschland dagegen nur zu 68%. Sie
erfuhren mit 43% eine ablehnende Haltung („Was soll das Kind denn mit
Griechisch?“) – deutsche Mütter in Griechenland nur zu 18%. Auch die
negativen Meinungen, im Land sei nur die Landessprache wichtig (GR:
33%, D: 52%) und Zweisprachigkeit sei eine Überforderung für das Kind
(GR: 48%, D: 88%), wurden den griechischen Müttern in Deutschland
gegenüber häufiger geäußert.
Ein
hohes Sprachprestige beeinflusst das konsequente
Spracherziehungsverhalten und die Zufriedenheit der Eltern mit dem
gesamten Verlauf des mehrsprachigen Entwicklungs- und
Erziehungsprozesses: In Griechenland verhalten sich 33% der Mütter
konsequent und 63% sind sehr zufrieden. In Deutschland verhalten sich
dagegen nur 20% konsequent und 48% sind sehr zufrieden.
top


Verweigerung des Gebrauchs der
Nichtumgebungssprache durch das Kind
Kinder
verweigern häufig (hier: zu 76%) indirekt oder direkt den Gebrauch der
Nichtumgebungssprache, also z.B. des Deutschen in Griechenland. Dieses
Verhalten steht in einem wechselseitigen Zusammenhang mit dem
Spracherziehungsverhalten: Spricht die deutsche Mutter ihr Kind auf
Deutsch an, und dieses antwortet auf Griechisch, hat dies oft (hier: in
46% der Fälle) zur Folge, dass nun auch die Mutter in die griechische
Sprache wechselt. Umgekehrt fordert die Inkonsequenz der Mutter
diejenige des Kindes heraus.
Eine
deutsche Mutter in Thessaloniki:
"Sie hat angefangen, griechisch mit mir zu sprechen. Ich habe versucht,
beim Deutschen zu bleiben, aber ich bin zunehmend auch zum Griechischen
gekommen."
 Mehrsprachige
Entwicklung
Mehrsprachige
Entwicklung
top


Förderung
der
Nichtumgebungssprache in Kindergarten und Schule
Die
sprachliche Ausrichtung von Kindergarten und Schule hat einen
indirekten und einen direkten Einfluss auf das
Spracherziehungsverhalten der Eltern: Die Feststellung, dass im
Kindergarten ausschließlich die Umgebungssprache gesprochen wird, ist
bei vielen Kindern (hier: 84%) der ausschlaggebende Moment, den
Gebrauch der Nichtumgebungssprache zu verweigern, was wiederum eine
konsequente Verwendung der Nichtumgebungssprache erschwert: Der
Prozentsatz konsequenter Mütter ist in einsprachigen Kindergärten mit
16% deutlich geringer als in zweisprachigen (53%): Hier erleben die
Kinder Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit als etwas Normales und
Verweigerungen treten
seltener auf (hier: in 58% der Fälle).
Hinzu
kommt, dass in einer zweisprachigen Einrichtung beide Sprachen
gleichberechtigt gefördert werden. Dadurch wird dasjenige Elternteil,
welches die Nichtumgebungssprache in der Familie vertritt, entlastet:
es liegt nicht mehr allein in seiner Verantwortung, ob und wie gut das
Kind die Sprache erwirbt.
Zudem
wird hier fachkompetente Beratung durch erfahrene Erzieher/innen
geboten sowie Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu Eltern, die sich in
einer ähnlichen spracherzieherischen Situation befinden.
All
dies schlägt sich auch in der Zufriedenheit der betroffenen Eltern mit
dem gesamten Prozess der mehrsprachigen Entwicklung und Erziehung
nieder: der Prozentsatz sehr zufriedener Mütter ist im zweisprachigen
Kindergarten (hier: 90%) wesentlich höher als im einsprachigen (hier:
43%).
 Mehrsprachigkeit
im Bildungssystem
Mehrsprachigkeit
im Bildungssystem
 Einstellungen pädagogischer Fachkräfte
Einstellungen pädagogischer Fachkräfte
top